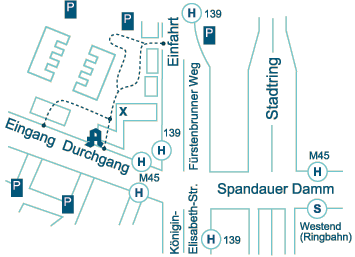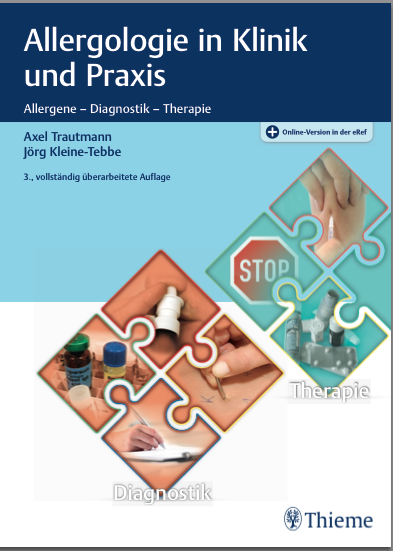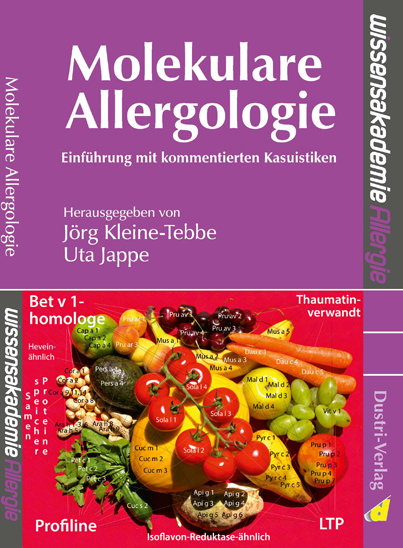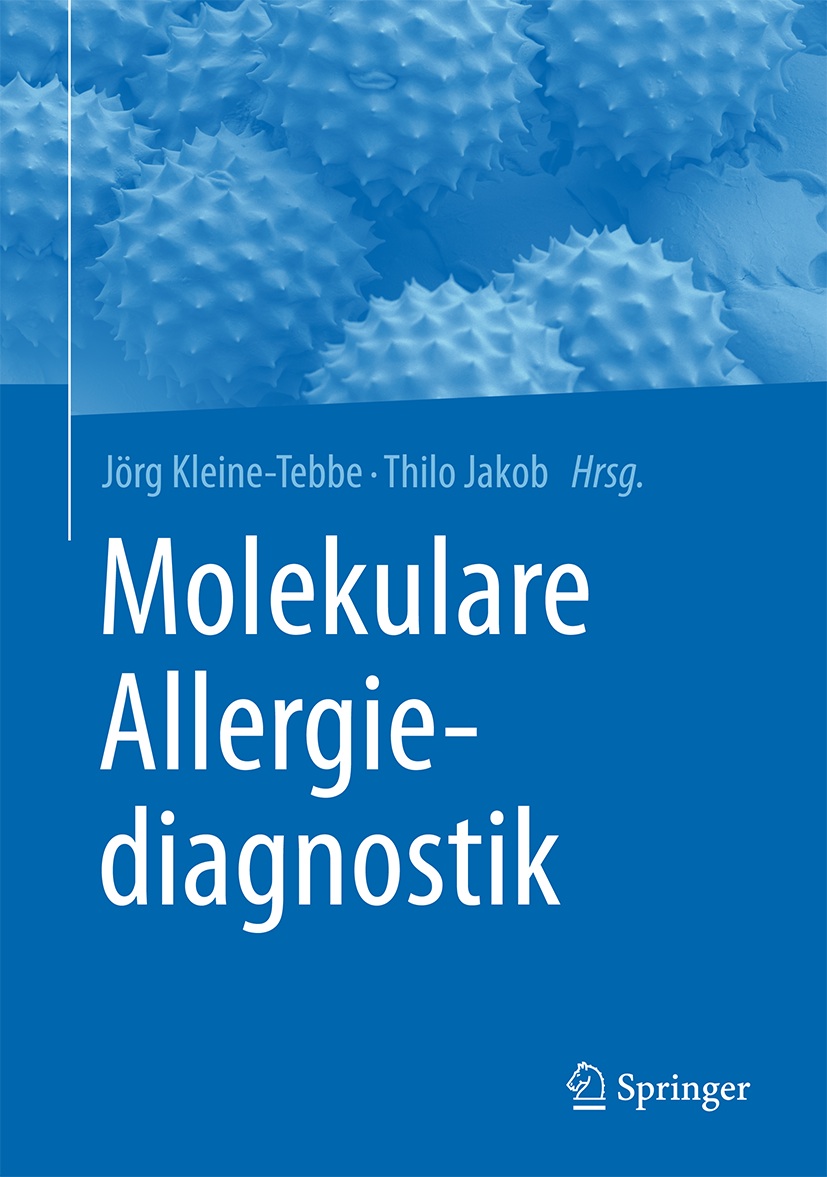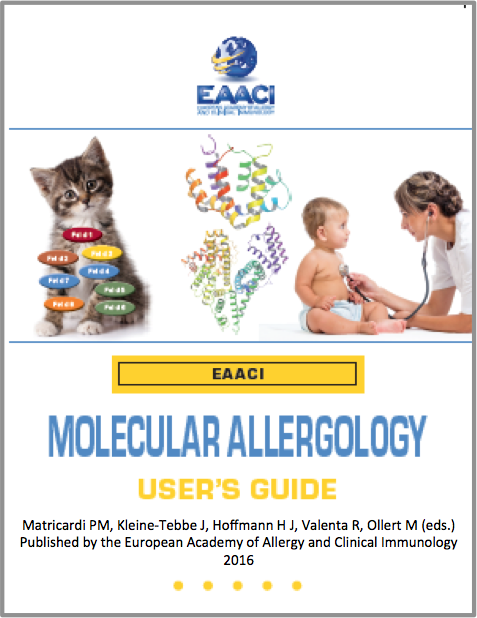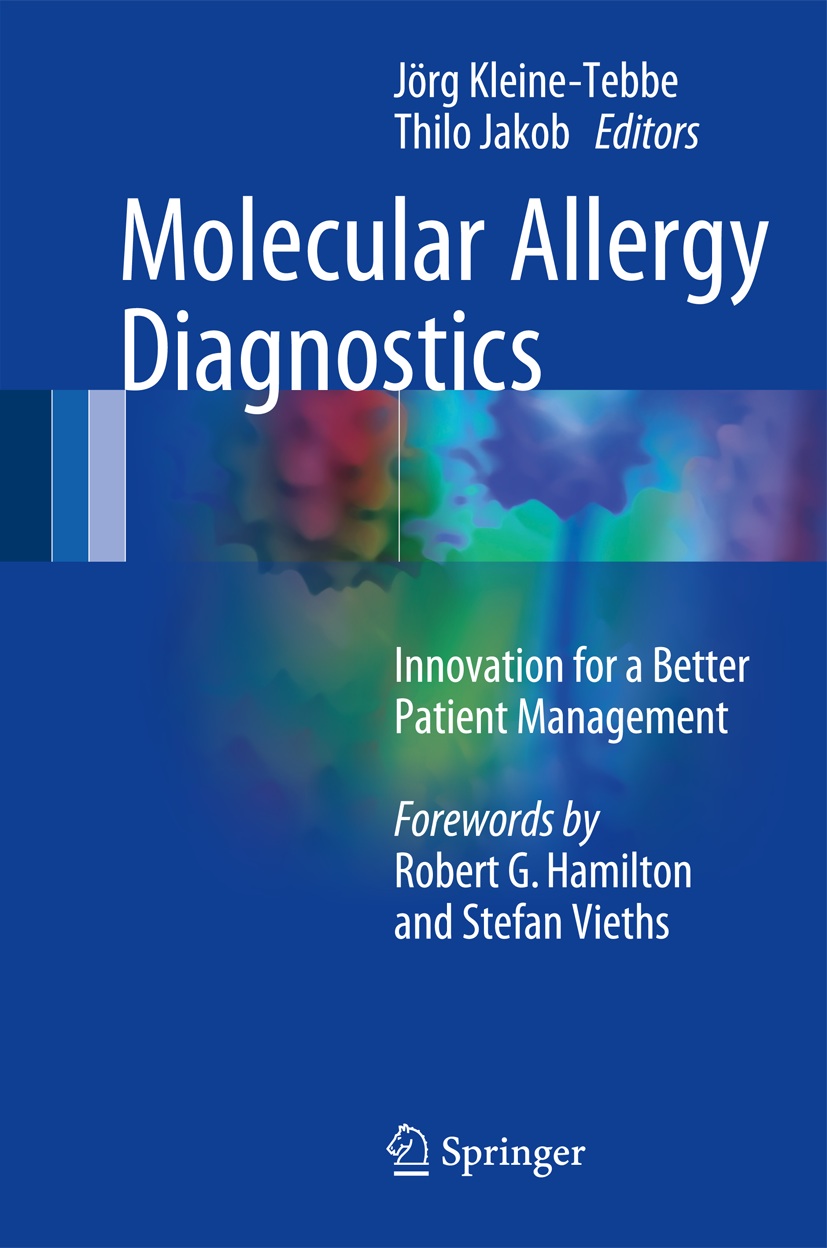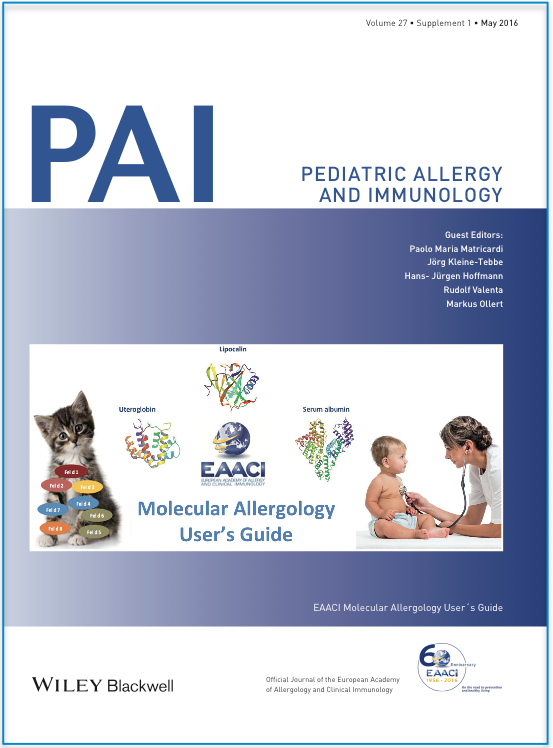Verzeichnis verwendeter Fachbegriffe
Akarazide
Milbenabtötende chemische Mittel, deren Wirksamkeit bei einer
Hausstaubmilbenallergie umstritten ist.
Allergen
Auslösender Stoff, der vom Immunsystem als fremd erkannt wird und dadurch eine
Überempfindlichkeit des Körpers verursacht. Bei Allergien der Schleimhäute (Augen,
Nase, Bronchien) sind es in der Regel Eiweißkörper, die eigentlich harmlos für unseren
Organismus sind (Pollen-, Tier- und Hausstaubmilbenbestandteile).
Allergenkarenz
Meiden des verantwortlichen Allergens
Allergentoleranz
Zustand des Immunsystems nach Erlöschen einer Abwehrreaktion gegen einen
bestimmten Stoff, der anschließend wieder vertragen wird.
Allergie
Überempfindlichkeit des Körpers, die „immunologisch“ bedingt ist, d.h. auf einer
fehlgeleiteten, übersteigerten Abwehr unseres Immunsystems beruht.
Antihistaminika
Medikamente, die zur Behandlung von allergischem Schnupfen eingesetzt werden. Sie
blockieren die Wirkung des Botenstoffes Histamin, der im Rahmen der allergischen
Reaktion im Körper freigesetzt wird und für zahlreiche Beschwerden verantwortlich ist.
Antikörper
Eiweißkörper, die vom Körper gebildet werden, um Fremdstoffe und unerwünschte
Erreger zu erkennen. Als Teil des Immunsystems lagern sie sich an den Fremdstoff an,
so daß er anschließend unschädlich gemacht werden kann.
Atopie
Erhöhte Allergiebereitschaft, die vererbt wird und im späteren Leben zu
Nahrungsmittelallergien, atopischem Ekzem, allergischem Schnupfen und allergischem
Asthma führen kann.
Atopiker
Menschen mit erhöhter Allergiebereitschaft, die häufig in ihrem Leben allergische
Erkrankungen entwickeln (Nahrungsmittelallergien, atopisches Ekzem, allergischer
Schnupfen und allergisches Asthma).
atopische Allergene
Eiweißstoffe aus unserer Umwelt, die bei Menschen mit erhöhter Allergiebereitschaft
häufig zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen, obwohl sie für den Nicht-Atopiker
ohne fehlgeleitetes Immunsystem völlig harmlos sind (Pollen, Tier- und
Hausstaubmilbenbestandteile).
atopisches Ekzem
Chronische Hauterkrankung, bei der stark juckende, ekzemartige Hauterscheinungen
in Schüben auftreten. Außerdem besteht häufig eine erhöhte Allergiebereitschaft,
allergischer Schnupfen oder allergisches Asthma.
Azelastin
Medikament aus der Gruppe der Antihistaminika, die die Wirkung des Botenstoffs
Histamin hemmen, der bei Allergien freigesetzt wird.
Acetylcholin
Botenstoff des vegetativen Nervensystems; er wird auch eingesetzt, um die allgemeine
bronchiale Überempfindlichkeit im Lungentest zu ermitteln.
B-Lymphozyten
= B-Zellen, spezialisierte Zellen des Immunsystems, die Fremdstoffe erkennen und
Antikörper produzieren können.
basophile Leukozyten
Weiße Blutkörperchen, die auf ihrer Oberfläche IgE-Antikörper tragen und daher zu
allergischer Reaktion fähig sind.
Berufsallergie
Eine allergische Überempfindlichkeit, die durch ständigen Kontakt mit bestimmten, im
Beruf vorkommenden Stoffen entstanden ist (z.B. Mehlallergie der Bäcker).
Beta2-Mimetika oder -Sympathomimetika
Asthmamedikamente, die nach Inhalation eine Verengung der Bronchien rasch wieder
beseitigen und dadurch Atemnot beheben können.
Bronchial-Asthma
Chronische Atemwegserkrankung, die auf einer Entzündung beruht und mit einer
Verengung der Bronchien und anfallsweise Atemnot einhergeht.
bronchiale Überempfindlichkeit, allgemeine
Gesteigerte Reaktionsfreudigkeit der Atemwege, so daß es bei zahlreichen
physikalischen oder chemischen Reizen zu einer meßbaren Verengung der Bronchien
und schließlich zu Schweratmigkeit kommen kann. Bei häufigen allergischen
Reaktionen der Bronchien (Asthma-Anfälle) entwickelt sich in vielen Fällen eine
Überempfindlichkeit auf andere unspezifische Reize (darum die Bezeichnung
allgemein).
Cetirizin
Medikament aus der Gruppe der Antihistaminika, die die Wirkung des Botenstoffs
Histamin hemmen, der bei Allergien freigesetzt wird.
Cromoglycinsäure
Anti-allergisches Medikament, das vorbeugend zur Behandlung von allergischen
Beschwerden an den Schleimhäuten (Augen, Nase, Bronchien) eingesetzt wird. Seine
Wirkung setzt mit Verzögerung ein.
DNCG
Häufig verwendete Abkürzung für Cromoglycinsäure-Präparate, die aus der englischen
Sprache abgeleitet ist.
Ebastin
Medikament aus der Gruppe der Antihistaminika, die die Wirkung des Botenstoffes H
istamin hemmen, der bei Allergien freigesetzt wird.
Ekzem
Chronische Entzündung der Haut, die mit juckenden Knötchen, geröteten
Hautbezirken, verstärkter Schuppung und vergröbertem Hautrelief einhergehen kann.
Eliminationsdiät
Gezieltes Weglassen eines Lebensmittels bei Verdacht einer Nahrungsmittelallergie
und Beobachtung der Beschwerden.
Enzyme
Eiweißkörper, die in Pflanzen und Tieren vorkommen und in der Lage sind, andere
chemische Bausteine (Eiweiß, Kohlenhydrate, Fette) zu spalten.
Eosinophile Leukozyten
Weiße Blutkörperchen, die häufig bei entzündlichen Reaktionen im Körper angelockt
werden und diese verstärken können.
Formula, extensiv hydrolysierte
Allergenarme, vollwertige Ersatznahrung für Hochrisikokinder mit stark erhöhtem
Allergierisiko, bei denen die Mutter das Kind während der ersten 6 Monate nicht stillen
kann.
genetische Disposition
Eigenschaft eines Organismus, die auf seiner Erbanlage beruht. Die Disposition
bezeichnet allerdings nur die erbbedingte Bereitschaft für eine Reaktionslage oder
Erkrankung. Diese Reaktionslage oder Erkrankung muß aber nicht notwendigerweise in
Erscheinung treten.
Histamin
Botenstoff, der bei allergischen Reaktionen freigesetzt wird und zahlreiche Symptome
verursacht (Juckreiz, Weitstellung der Blutgefäße, Schwellung im Gewebe,
Drüsensekretion).
Hochrisikokind
Kind mit stark erhöhtem Allergierisiko; man kann davon ausgehen, daß, wenn zwei
Verwandte ersten Grades (Eltern und/oder Geschwister) bereits von Allergien bzw.
begleitenden Erkrankungen betroffen sind (allergischer Schnupfen, allergisches
Bronchialasthma, atopisches Ekzem, Nahrungsmittelallergie), ein hohes Risiko für das
Kind besteht, ebenfalls eine Allergie zu entwickeln.
Hyposensibilisierung
= Immuntherapie; Methode zur Behandlung von allergischen Beschwerden der
Schleimhäute (Augen, Nase, Bronchien). Zunächst werden im Wochenabstand
steigende Mengen des verantwortlichen Allergens unter die Haut gespritzt; nach
Erreichen einer individuell verträglichen Höchstdosis werden die Spritzen alle vier
Wochen für drei Jahre verabreicht. Die Behandlung sollte nur von einem allergologisch
erfahrenen Arzt durchgeführt werden.
IgE
= Immunglobuline der Klasse E; Antikörper, die im menschlichen Körper in geringer
Menge vorkommen und auf der Oberfläche von spezialisierten Abwehrzellen
(Mastzellen, basophile Leukozyten) haften. Bei erhöhter Allergiebereitschaft werden
IgE-Antikörper häufig vermehrt vom Körper produziert und sind meistens gegen
Eiweißkörper aus unserer Umwelt (Allergene wie z.B. Pollen-, Tier- und
Hausstaubmilbenbestandteile) gerichtet. Bei Schleimhautkontakt werden die Allergene
von den IgE-Antikörpern auf den Mastzellen gebunden. Dadurch startet die Freisetzung
von zahlreichen Botenstoffen, die zu den allergischen Beschwerden führen.
Immunglobulin
= Antikörper; Eiweißkörper, die vom Körper gebildet werden, um Fremdstoffe und
unerwünschte Erreger zu erkennen. Als Teil des Immunsystems lagern sie sich an den
Fremdstoff an, so daß er anschließend unschädlich gemacht werden kann.
Immunsystem
System zur körpereigenen Abwehr; das Immunsystem kann zwischen „selbst“ (also den
körpereigenen Stoffen) und „fremd“ (z.B. Stoffen von unerwünschten Erregern wie
Bakterien, Pilzen, Viren) unterscheiden. Bei fehlgeleitetem Immunsystem können auch
harmlose Umweltstoffe (Allergene wie z.B. Pollen-, Tier- und
Hausstaubmilbenbestandteile) oder körpereigene Stoffe attackiert werden.
immunologisch
Das Immunsystem betreffend.
Immuntherapie
Eine Behandlungsform, bei der in das Immunsystem eingegriffen wird. Im
Zusammenhang mit Allergien ist eine Behandlung mit den verantwortlichen Allergenen
gemeint, die in steigender Dosis unter die Haut gespritzt werden (=
Hyposensibilisierung).
Intoleranz
Überempfindlichkeit des Körpers auf bestimmte Stoffe, die nicht notwendigerweise auf
einer fehlgeleiteten Immunreaktion beruht, sondern durch andere Mechanismen
verursacht sein kann.
Intrakutantest
Allergietest, bei dem das verdächtige Allergen als stark verdünnte Lösung in die Haut
gespritzt wird. Bei positivem Ergebnis entsteht nach etwa zehn Minuten eine juckende
Quaddel mit rotem Hof.
Kortikosteroide
Vereinfacht meist nur Kortison genannt, Gruppe von Hormonen der Nebennierenrinde,
die der körpereigenen „Streßabwehr“ dienen und zahlreiche Stoffwechsel- und
Wachstumsvorgänge regulieren. Sie haben außerdem einen direkten Einfluß auf das
Immunsystem und vermindern entzündliche Vorgänge im Körper.
Kortison
Häufig verwendete Kurzform eines Vertreters der Kortikosteroide.
Levocabastin
Lokal wirksames Medikament aus der Gruppe der Antihistaminika, die die Wirkung des
Botenstoffs Histamin hemmen, der bei Allergien freigesetzt wird.
Loratadin
Medikament aus der Gruppe der Antihistaminika, die die Wirkung des Botenstoffs
Histamin hemmen, der bei Allergien freigesetzt wird.
Mastzellen
Spezialisierte Abwehrzellen, die auf ihrer Oberfläche IgE-Antikörper tragen und bei
verschieden Reizen (z.B. Allergenkontakt) Botenstoffe freisetzen, die für allergische
Symptome verantwortlich sind.
Mediatoren
Botenstoffe, die im Körper bestimmte Signale übermitteln (z.B. Verstärkung einer
Entzündungsreaktion).
Nedocromil
Antiallergisches Medikament, das vorbeugend zur Behandlung von allergischen
Beschwerden an den Schleimhäuten (Augen, Nase, Bronchien) eingesetzt wird. Es
mildert die allergische Entzündung und hat durch seine lokale Anwendung (z.B. als
Spray) nur wenig unerwünschte Begleiterscheinungen.
Nesselsucht
= Urtikaria, akut auftretende Hauterscheinungen wie nach Brennesselkontakt oder
Mückenstich, die mit juckenden Quaddeln an wechselnden Körperstellen einhergehen
und häufig nach wenigen Stunden oder Tagen wieder abklingen.
Neurodermitis
= atopisches Ekzem, wobei stark juckende, ekzemartige Hauterscheinungen in Schüben
auftreten. Außerdem besteht häufig eine erhöhte Allergiebereitschaft, allergischer
Schnupfen oder allergisches Asthma.
Neuropeptide
Botenstoffe, die von Nervenenden freigesetzt werden, das Immunsystem beeinflussen
und zu einer lokalen Entzündung im Körpergewebe führen können. Wechselwirkungen
zwischen psychischem und körperlichem Befinden beruhen möglicherweise unter
anderem auf der Ausschüttung von Neuropeptiden.
orale Hyposensibilisierung
Immuntherapie mit Allergenen, die in steigenden Mengen in Tropfen- oder Kapselform
eingenommen werden. Da kontrollierte Untersuchungen zu unterschiedlichen
Ergebnissen geführt haben, ist die Wirksamkeit dieser Behandlung nicht eindeutig
erwiesen.
Patchtest (Pflastertest)
Allergietest zur Erkennung einer Spättypallergie (Typ-IV-Allergie), die mit einer
Verzögerung von 2 bis 3 Tagen zu einer Entzündung der Haut führt (Ekzem). Die
verdächtigen Allergene (z.B. Nickelverbindungen) werden mit Salbe vermischt undunter einem Klebeplaster für 2 bis 3 Tage am Rücken mit der Haut in Kontakt gebracht
(darum auch Kontaktallergie). Die positive Reaktion ist eine umschriebene
Ekzemreaktion mit entzündlichen Knötchen auf geröteter Haut.
Peakflowmeter
Kleines, tragbares Meßgerät zur Messung des Atemstoßes. Es wird häufig von
Patienten mit Asthma verwendet und erleichtert die Beurteilung des momentanen
Zustandes der Atemwege.
Plasmazellen
Spezialisierte Immunzellen, die sich aus den B-Lymphozyten entwickeln und in den
Lymphknoten große Mengen von Antikörpern produzieren.
Plazebo
Scheinmedikament (z.B. Tablette mit Originalgröße, aber ohne Wirkstoff), das
eingesetzt wird, um die Einflüsse einer Behandlung zu prüfen, die nicht auf der
spezifischen Wirkung der Behandlung beruhen. Dieser sog. Plazeboeffekt kommt u.a.
durch „spontane Heilungen“, „Überzeugungskraft des Therapeuten“ und
„Autosuggestion des Behandelten“ zustande.
Pollenflugsaison
Zeitraum, in dem eine Pflanze blüht und ihre Pollen in großer Menge freisetzt.
Pricktest
Allergietest zur Erkennung einer Soforttypallergie (Typ-I-Allergie), die rasch nach
Allergenkontakt zur einer Reaktion an der Haut oder der Schleimhaut führt. Die
verdächtigen Allergene (z.B. Pollen, Tier- oder Hausstaubmilbenbestandteile) werden
als Lösung auf die Haut getropft, bevor mit einer Nadel in die Haut gepiekt („geprickt“) wird.
Proteine
Eiweißkörper
Provokationstest
Allergietest, bei dem das vermutete Allergen direkt an der Schleimhaut (z.B. Augen,
Nase, Magen und Darm) getestet wird. Bei positivem Verlauf setzen nach kurzer Zeit
(10 bis 20 Min., im Verdauungstrakt z.T. verzögert) die allergischen Beschwerden ein.
An den Bronchien wird ein Provokationstest häufig mit sog. unspezifischen Reizen
durchgeführt (Inhalation bronchialreizender Stoffe, Kaltluftinhalation). Ist eine
Verengung der Bronchien meßbar, besteht eine allgemeine bronchiale
Überempfindlichkeit, die als Vorstufe und häufige Grundlage eines Bronchialasthmas
gilt.
Pseudoallergie
Reaktionen des Körpers, die einer allergischen Reaktion ähneln, allerdings nicht
immunologisch bedingt sind. Die Mechanismen, die sich hinter diesem Sammelbegriff
verbergen, sind weitgehend unklar.
Quaddel
Juckende Erhebung der Haut (z.B. nach Brennesselkontakt oder Mückenstich).
Rezeptoren
Bindungs- oder Kontaktstellen für bestimmte chemische Bausteine (Botenstoffe,
Überträgerstoffe, Proteine, Hormone u.a.), die nach dem Schlüssel-Schloßprinzip in
verschiedenen Körperzellen Signale auslösen.
Scratchtest
= Kratztest; nachdem die Haut aufgerauht wurde (scratch = kratzen), werden
angefeuchtete Allergene auf den Hautbezirk gelegt. Bei positiver Reaktion entsteht eine
juckende Quaddel mit geröteter Umgebung.
Sensibilisierung
Prozeß der Entwicklung einer Allergie vom allerersten Allergenkontakt bis zu dem
Zeitpunkt, an dem eine nachweisbare Überempfindlichkeit des Immunsystems
entstanden ist. Bei Schleimhautallergien ist es die Zeit zwischen der ersten Inhalation
eines Allergens und dem Auftreten von IgE-Antikörpern gegen diesen Fremdstoff, das
meistens einen positiven Hauttest verursacht.
Soforttyp-Allergie
= Typ I-Allergie, immunologisch bedingte Überempfindlichkeit gegen harmlose
Eiweißstoffe, die sich in einer rasch auftretenden Reaktion an der Haut, Schleimhaut
oder am ganzen Körper äußern kann. Der allergisch bedingte Schnupfen bzw. das
allergische Bronchialasthma gehören u.a. zu den Krankheiten, die durch eine
Soforttyp-Allergie verursacht sein können.
Spättyp-Allergie
= Typ IV-Allergie, = Kontaktallergie, immunologisch bedingte Überempfindlichkeit
gegen kleine chemische Bausteine aus der Umwelt, die nach Kontakt verzögert nach 1
bis 2 Tagen zu einer Ekzemreaktion der Haut führen können. Die Allergie gegen Metalle
(Nickel, häufiger Bestandteil im Modeschmuck) ist das häufigste Beispiel der Spättyp-
oder Kontaktallergie.
Steroide
Kurzform für Kortikosteroide; Hormone der Nebennierenrinde, die der körpereigenen
„Streßabwehr“ dienen und zahlreiche Stoffwechsel- und Wachstumsvorgänge
regulieren. Sie haben außerdem einen direkten Einfluß auf das Immunsystem und
vermindern entzündliche Vorgänge im Körper.
Sympathomimetika
= Beta2-Mimetika; Asthmamedikamente, die nach Inhalation eine Verengung der
Bronchien rasch wieder beseitigen und dadurch Atemnot beheben können.
T-Lymphozyten
= T-Zellen; spezialisierte Immunzellen, die Bruchstücke von Fremdstoffen, die ihnen
von den Freßzellen präsentiert worden sind, erkennen und anschließend wichtige
Signale für die Immunreaktion geben. Bei Allergien sind es kleine Stücke des Allergens,
die von den T-Lymphozyten erkannt werden. Dadurch aktiviert, helfen sie u.a. den B-
Lymphozyten bei der Antikörperproduktion.
Terfenadin
Medikament aus der Gruppe der Antihistaminika, die die Wirkung des Botenstoffs
Histamin hemmen, der bei Allergien freigesetzt wird.
Theophyllin
Medikament zur Asthmatherapie; bei regelmäßiger Einnahme hält es die Bronchien
weit und verhindert die Atemnot beim Bronchialasthma.
Typ I-Allergie
Siehe Soforttyp-Allergie.
Typ III-Allergie
Seltene Allergieform, bei der es nach Allergenkontakt durch Antikörper zu einer
Entzündung in verschiedenen Organen kommen kann (z.B. Lungenentzündung nach
Sensibilisierung gegen Vogelbestandteile, sog. Vogelzüchterlunge).
Typ IV-Allergie
= Kontaktallergie, siehe Spättyp-Allergie.
Urtikaria
= Nesselsucht; akut auftretende Hauterscheinungen wie nach Brennesselkontakt oder
Mückenstich, die mit juckenden Quaddeln an wechselnden Körperstellen einhergehen
und häufig nach wenigen Stunden oder Tagen wieder abklingen.
zurück zum Inhalt
 Seitenanfang
Seitenanfang